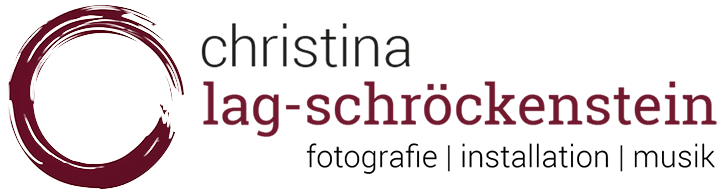Denk.mal
Denk.mal
In den letzten Jahren scheinen wir unsere Weltsichten und Wahrnehmungen des Zeitgeschehens – und damit auch die Tragweite und Wirkmacht unserer Bürger- und Freiheitsrechte – immer mehr durch limitiertes, engmaschiges und von Kontrasten geprägtes Denken einzuschränken. Und das nicht nur gezwungenermaßen, sei es durch wachsende Radikalismen innerhalb unserer Gesellschaft oder durch den angstbesetzten kollektiven Stress einer pandemischen Krise, sondern gleichzeitig und Hand in Hand auch aufgrund unreflektierter Freiwilligkeit. Denn die medialen Strukturen und Mechanismen, innerhalb derer wir uns heute bewegen, garantieren uns lediglich den Frieden unserer Blase, unserer Box, und gaukeln uns virtuelle Freiheiten vor, die in Wahrheit nur der Nährboden für reale innergemeinschaftliche Spaltungstendenzen sind.
Je kleiner der Bewegungsradius unserer Zeitgenossenschaft, je höher der Tellerrand unserer Ver- einzelung, je fixierter der Tunnelblick unserer Meinungen, desto einfacher wird es, unsere Frei- heits- und Friedenssehnsucht als etwas zu begreifen, das gegen andere durchgesetzt werden muss. Desto leichter fällt es, Freiheiten und Rechte als Verlangen zu empfinden, anstatt sie als Pflichten anzuerkennen. Desto eher vergessen wir dabei auf die schwerwiegendste Pflicht zur Freiheit: uns über die grausamen Ereignisse des Krieges und der Menschenvernichtung bewusst zu sein, aus deren schändlicher Asche sie vor 75 Jahren entstand.
Dies bedeutet jedoch nicht nur, sich dieses Ursprungs gewahr zu sein oder seiner Opfer zu gedenken, sondern auch stets zu bedenken, dass unsere Erinnerungs-, Gedenk- und Mahnkultur seit jeher selbst fragmentiert und auf je einzelne Blickwinkel beschränkt ist. Unterschiedlichste Mahnmale in unserer Republik gedenken der Opfer des Nationalsozialismus – oft genug auf um- strittene Weise. Mal erinnern sie an gefallene Soldaten, aber nicht an jene, die Widerstand gegen das Regime leisteten oder der Shoah zum Opfer fielen. Mal gemahnen sie nicht bloß an die Schrecken des Krieges, sondern manifestieren auch den Verantwortung verdrängenden Opfermy- thos des postnazistischen Österreich. Und mal stehen übrig gebliebene Machtrelikte des Natio- nalsozialismus jahrzehntelang wie gespenstische Heimsuchungen in der Landschaft, ehe ihnen in mühsamer, schmerzhafter und langwieriger Arbeit eine Zukunft als Mahnmal abgerungen wird. Wie wir uns der Vergangenheit unserer Heimat erinnern, beeinflusst auch die Vision, die wir von ihrer Zukunft haben. Wie sehr wir uns des Ursprungs der Freiheit, mit der wir in ihr leben, bewusst sind, prägt auch unser Verständnis, unsere Wahrnehmung und unsere Gestaltung dieser Freiheit. Die Pflicht zur Freiheit, so sie kein Opfer der Vereinzelung, des Gegeneinanders werden soll, be- deutet, unsere Engstirnigkeiten und Fragmentierungen zu überwinden, aus unseren Blasen und Boxen zu treten. Diese Pflicht, sie ist vor allem der Akt einer nachhaltigen Selbstreflexion, einer tiefgreifenden Selbstkritik und einer konstruktiven Skepsis eigenen Standpunkten gegenüber.
In recent years, we seem to be increasingly limiting our worldviews and perceptions of current events – and thus also the scope and efficacy of our civil rights and liberties – through limited, narrow-meshed thinking characterized by contrasts. And this is not only forced, be it by growing radicalisms within our society or by the fearful collective stress of a pandemic crisis, but at the same time and hand in hand also due to unreflective voluntarism. For the media structures and mechanisms within which we move today merely guarantee us the peace of our bubble, our box, and delude us with virtual freedoms that are in reality only the breeding ground for real intra-community divisive tendencies.
The smaller the radius of movement of our contemporaneity, the higher the rim of our isolation, the more fixed the tunnel vision of our opinions, the easier it becomes to understand our longing for freedom and peace as something that must be asserted against others. The easier it is to perceive freedoms and rights as desires instead of recognizing them as duties. The more likely we are to forget the most serious duty of freedom: to be aware of the cruel events of war and human annihilation, from whose shameful ashes it arose 75 years ago.
However, this does not only mean to be aware of this origin or to remember its victims, but also to always keep in mind that our culture of remembrance, commemoration and memorialization has always itself been fragmented and limited to individual perspectives. A wide variety of memorials in our republic commemorate the victims of National Socialism – often enough in controversial ways. Sometimes they commemorate fallen soldiers, but not those who resisted the regime or fell victim to the Shoah. Sometimes they not only commemorate the horrors of war, but also manifest the responsibility-displacing victim myth of post-Nazi Austria. And sometimes the remaining relics of National Socialist power stand for decades like ghostly hauntings in the landscape, before a future as a memorial is wrested from them in painful and tedious work. How we remember our homeland’s past also influences the vision we have of its future. How aware we are of the origin of the freedom with which we live in it also shapes our understanding, perception and shaping of that freedom. The duty to freedom, if it is not to become a victim of isolation, of opposition, means to overcome our narrow-mindedness and fragmentation, to step out of our bubbles and boxes. This duty, it is above all the act of a sustainable self-reflection, a profound self-criticism and a constructive skepticism towards one’s own points of view.